Semesterabschlussprojekt
Studierende entwickeln Podcast zu Sprache und Identität
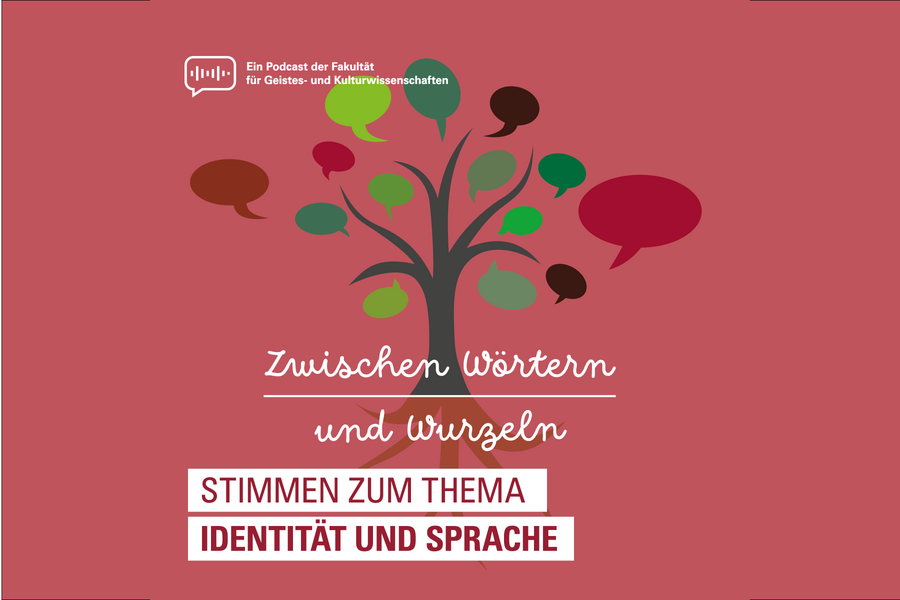
„Die grundsätzliche Idee war, dass die Studierenden das notwendige Wissen und Können aufbauen, um Projekte wie die Entwicklung eines Podcasts auch an Schulen zu initiieren“, erklärt Prof. Dr. Kirsten Schindler. Sie hat das Seminar für Studierende im Master Grundschullehramt und Sonderpädagogik gemeinsam mit Hanna Hauch vom Netzwerk Digitalisierung Lehre (BU:NDLE) veranstaltet – eine Zusammenarbeit, die Schindler als sehr gelungen beschreibt. Inhaltlich ging es bei der Lehrveranstaltung um Sprache und Identität. „Wir haben das Thema ausgewählt, weil es viele Facetten hat und für den Schulunterricht viele Anknüpfungspunkte bietet“, so Schindler.
Von der Idee zur Umsetzung
Im Seminar beschäftigten sich die Studierenden zunächst mit der Gattung Podcast, sie reflektierten eigene Vorlieben und Hörgewohnheiten und lernten zentrale Merkmale der Gattung zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit kennen. Ein zweiter Schwerpunkt lag dann auf dem Thema Sprache und Identität, dabei ging es um sprachliche Vielfalt, Prestigesprachen, Jugendsprache u. a. Themen, die auch in den Podcasts aufgegriffen bzw. erweitert wurden.
Die Studierenden lernten dann, wie man ein Skript für einen Podcast entwickelt und übten sich im Sprechen. Mit Abschluss der Recherche, Konzeption und Planung ging es dann in die Podcast-Kabine, die im Future of Learning Lab der Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaften eingerichtet ist. Anschließend haben sie ihre Aufnahme bearbeitet und geschnitten. Den Abschluss bildete die Beschreibung für Spotify und den Deutschdidaktik Instagram Account.
Authentische Lernerfahrungen
„Wir glauben, dass diese authentischen Lernerfahrungen für Studierende im Lehramt wichtig sind und so auch die Hürden verringert werden, um selbst solche Projekte in der Schule umzusetzen“, sagt Kirsten Schindler. Einige der Studierenden werden ihr gewonnenes Wissen nun tatsächlich in ihrem bald anstehenden Praxissemester erproben und einen Podcast mit ihren Schüler*innen produzieren.
Eine von ihnen ist Linda Wilke. Im Interview berichtet sie über ihre persönliche Verbindung zum Thema und die Produktion des Podcasts.
Was hat Sie persönlich am Thema „Sprache und Identität“ interessiert, und warum halten Sie es für relevant im schulischen Kontext?
Durch meine familiäre Herkunft und meine bisherigen Erlebnisse, habe ich einen persönlichen Bezug zum Thema Sprache und Identität. Ich sehe dieses Thema in der heutigen Zeit besonders für Menschen, die mehrsprachig aufgewachsen sind, aber auch für Menschen, die es nicht sind, als aktuell an. Besonders an Schulen ist Toleranz und Aufklärung notwendig.
Welche Aspekte von Sprache und Identität beleuchtet Ihre Podcastfolge, und warum haben Sie gerade diesen Schwerpunkt gewählt?
Meine Gruppe hat die Episode „Sprache als Prestige – zwischen Stolz und Vorurteilen.“ produziert. In dieser Episode geht es um das mehrsprachige Aufwachsen einer Kommilitonin und mir. Wir gehen dabei auf unsere familiären Besonderheiten ein und stellen heraus, wieso es auch manchmal schwierig ist, mehrsprachig aufzuwachsen. Wir haben diesen persönlichen Schwerpunkt gewählt, weil wir in unseren Tätigkeiten in Schulen bemerkt haben, dass es immer noch Vorurteile unter den Schüler*innen oder auch unter Lehrkräften zu Mehrsprachigkeit gibt. Wir möchten mit unserer Episode auf die vielen Vorteile eines mehrsprachigen Aufwachsens hinweisen und appellieren für mehr Toleranz und Freude im Umgang mit Migration und Mehrsprachigkeit.
Wie sind Sie und Ihre Gruppe bei der Entwicklung vorgegangen – von der Themenfindung bis zur Umsetzung?
Wir haben mit der groben Themenvorgabe „Sprache und Identität“ direkt an unsere eigenen Biografien denken müssen. Weil sich meine Gruppe bereits untereinander kannte, wussten wir von unseren verschiedenen und teils außergewöhnlichen Herkunftsgeschichten. Diese unterscheiden sich in einigen Punkten, deswegen haben wir uns für eine Gegenüberstellung zweier familiärer Geschichten entschieden. Unsere Episode ist daher ein Interview bestehend aus drei Personen. Nachdem wir uns auf unser Thema und den groben Inhalt geeinigt haben, haben wir mögliche Interviewfragen entwickelt, die uns die Moderation unserer Teams in der Episode abwechselnd stellen konnte. Wir haben unseren Ablauf vor der Aufnahme geprobt, dann aber direkt aufgenommen. Wir wollten dadurch den persönlichen und offenen Interviewcharakter nicht verlieren.
Welche Herausforderungen gab es bei der Erstellung des Podcast, und wie haben Sie diese gemeistert?
Eine Herausforderung bestand vor allem in der Aufnahme. Wir haben die Episode mit professionellem Equipment aufgenommen, das jedes noch so kleine Geräusch mit aufgenommen hat. Wir mussten daher in der Aufnahmekabine sehr still und konzentriert aufnehmen. Außerdem mussten wir beachten, dass wir die Notizen unseres Skripts nicht einfach nur ablesen, sondern auch frei und offen sprechen. Besonders für unseren Podcast-Typen ist es wichtig, dass wir frei und authentisch gesprochen haben.
Welche Potenziale sehen Sie darin, solche Projekte in den Schulunterricht zu integrieren?
Ich setze die gelernten fachlichen und didaktischen Kompetenzen im kommenden Frühling ein, um mit einer inklusiven Grundschulklasse einen eigenen Podcast zu produzieren. Das Seminar hat mir dafür die nötigen Grundlagen vermittelt und mich dazu inspiriert, das Medium Podcast mit Schüler*innen der Klasse drei und vier umzusetzen. Über die Umsetzung und möglichen Förderpotenziale werde ich bei Professorin Schindler auch meine Masterthesis schreiben. Ich sehe genauso viele Potenziale in der unterrichtlichen, wie auch in der universitären Umsetzung. Besonders für Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf oder mit Deutsch als Zweitsprache könnte die Produktion oder auch Rezeption von Podcasts im Unterricht ein großer Gewinn sein. Ich bin gespannt, wie die Umsetzung mit meinen Grundschüler*innen gelingen wird!
Zwischen Wörtern und Wurzeln
Insgesamt sind – in Gruppenarbeit zu dritt – neun Folgen entstanden. Darin geht es unter anderem darum, wie Jugendwörter unsere Sprache prägen, um die Tücken von maschinellen Übersetzungen sowie die faszinierende Welt der Mehrsprachigkeit.
Der Podcast kann über Spotify abgerufen werden.
